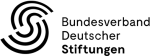Christa Seric-Geiger Preis

Skulptur des Künstlers Alija Resic

Christa Seric-Geiger Preis 2025
„Mit dem Christa Seric-Geiger Preis ehrt die Carl-Friedrich Geiger Stiftung seit 2021 jährlich Frauen, die sich auf herausragende Weise in der medizinischen Forschung, in Kunst und Kultur, in kulturellen und sozialen Einrichtungen wie auch für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern verdient gemacht haben.
Der Preis ist dotiert mit 20.000,00 Euro sowie einer Skulptur des Künstlers Alija Resic.
Das Kuratorium kann jährlich wechselnde Schwerpunkte benennen.
"Für den Christa Šerić-Geiger Preis 2025 können sich Frauen bewerben oder vorgeschlagen werden, die in der Wissenschaft und/oder Bildung tätig sind.
Die Ausschreibung konzentriert sich dabei auf Leistungen in der Forschung oder Lehre, die sich mit den Auswirkungen der Sozialen Medien auf die Gesellschaft beschäftigen."
Der Ort der Preisverleihung ist Kehl am Rhein. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Teilnahmebedingungen und Auswahl
Für die Berücksichtigung des Vorschlags im Auswahlverfahren sind erforderlich:
Aus den eingereichten Vorschlägen ermittelt eine Jury die Preisträgerin, deren Name im November 2024 bekanntgegeben wird. Die feierliche Preisverleihung findet im März 2025 in Kehl am Rhein statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Bewerbungen können eingesandt werden an:
Die Bewerbungen können eingesandt werden an:
Carl-Friedrich Geiger Stiftung
Querstraße 2a
77694 Kehl am Rhein
oder per E Mail:
Die Stifterin Christa Seric-Geiger
Christa Seric-Geiger wurde 1944 als Tochter einer Französin und eines Deutschen in Kehl am Rhein geboren.
Dort ist sie aufgewachsen in einer Zeit, als die Grenzregion noch geprägt war von der Erinnerung an die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. An offene Grenzen mochte damals niemand denken, aber der Brückenschlag über den Rhein und die deutsch-französische Freundschaft wurden in den Jahren ihrer Kindheit und Jugend zum Motor der europäischen Integration. Als Vierzigjährige erlebte sie den Fall der Schlagbäume, wenige Jahre später dann die Folgen eines neuen Krieges mitten in Europa, auf dem Balkan. Auch Angehörige ihres Mannes wurden aus der bosnischen Heimat vertrieben. In Kehl half Christa Seric-Geiger geflüchteten Verwandten beim Aufbau einer neuen Existenz, der Überwindung ihrer Kriegstraumata. Der Wunsch nach einem einigen, friedlichen Europa wurde durch diese Erfahrungen noch stärker.

Als ihr Vater Carl-Friedrich Geiger starb, übernahm Christa Seric-Geiger das von ihm aufgebaute weit verzweigte Familienunternehmen und gründete 2006 die Carl-Friedrich Geiger Stiftung.
Sie verschaffte sich Anerkennung und Respekt als Frau in der Autobranche, einer hart umkämpften Männerdomäne. Zum Ende ihrer beruflichen Karriere musste die couragierte Unternehmerin auch Rückschläge hinnehmen, Verluste und menschliche Enttäuschungen verkraften.
Dennoch blieb sie bis zu ihrem plötzlichen Tod im März 2019 ihren Werten treu:
![]() Optimismus
Optimismus
![]() Wagemut
Wagemut
![]() Empathie
Empathie
![]() und Herzlichkeit
und Herzlichkeit
Zum ersten Todestag der Stifterin am 06. März 2020 organisierte die Stiftung die Veranstaltung „In Memoriam“ an der der Christa Seric-Geiger Preis ausgerufen wurde:
(Die Rede beginnt ab Minute 1.13 )
Der Künstler Alija Resic

Der Bildhauer Alija Resic wurde 1952 in Prijedor (Bosnien und Herzegowina) geboren. Der Bildhauer absolvierte seine akademische Ausbildung an der Akademie der angewandten Kunst an der Universität Zagreb (1980).
Er arbeitet seit mehr als 40 Jahren als selbstständiger Künstler. Seine Werke –Skulpturen, Zeichnungen und Gemälde – wurden bei zahlreichen Ausstellungen in Kroatien und im Ausland präsentiert. Der Künstler lebt und arbeitet in Istrien (Kroatien) und wurde vielfach für seine Arbeiten ausgezeichnet.
Beiträge
Nomi Baumgartl und Jana Erb sind die Preisträgerinnen des Christa Seric-Geiger Preises 2024
Nomi Baumgartl und Jana Erb sind die Preisträgerinnen des Christa Seric-Geiger Preises 2024. Beide Frauen schaffen mit ihrer Fotokunst Bewusstsein für den Klimawandel.
Mehr lesenDie Violinistin und Menschenrechtsaktivistin Marina Bondas ist Preisträgerin 2023
Für ihr Engagement im Kriegsgebiet mit ihrer Initiative „Heart for Ukraine“ wurde Marina Bondas am 11. März 2023 mit dem Christa Seric-Geiger Preis ausgezeichnet.
Mehr lesenDie „Königin der Epigenetik“ erhielt den Christa Seric-Geiger Preis 2022
Ein Abend der bewunderungswürdigen Frauen – das war die Verleihung des Christa Seric-Geiger Preises im Kehler Kulturhaus am 4. März 2022.
Mehr lesenMenschlichkeit in der Pandemiebekämpfung
Sie macht einfach! Nicht ohne zu überlegen. Sie macht gerade deshalb, weil sie zuvor sehr viel und sehr schnell überlegt hat. Entschlossenheit, Kreativität und ärztliches Ethos prägen das Denken und Handeln von Dr. Lisa Federle.
Mehr lesenDr. Lisa Federle ist die erste Trägerin des Christa Seric-Geiger-Preises
Der von der Carl-Friedrich Geiger-Stiftung zu Ehren ihrer Stifterin ins Leben gerufene Christa Seric-Geiger-Preis geht in diesem Jahr an Dr. Lisa Federle.
Mehr lesenFestakt zum Todestag von Christa Seric-Geiger
Die Carl-Friedrich-Geiger-Stiftung würdigte noch einmal die Verdienste der im vergangenen Jahr verstorbenen Unternehmerin Christa Seric-Geiger. Es entsteht ein neuer Preis.
Mehr lesenChrista Seric-Geiger Preis ausgerufen
Im Rahmen der Hommage an sie und ihr Lebenswerk verkündete ihr Ehemann und Vorsitzender des Kuratoriums Fadil Seric die Ausschreibung eines Preises mit ihrem Namen. Der Preis …
Mehr lesen